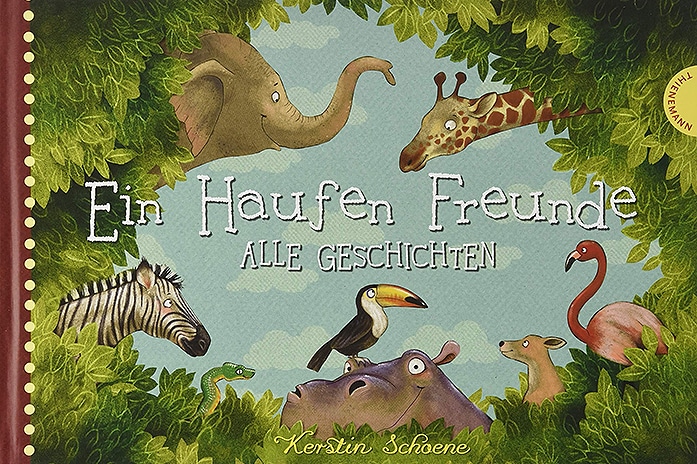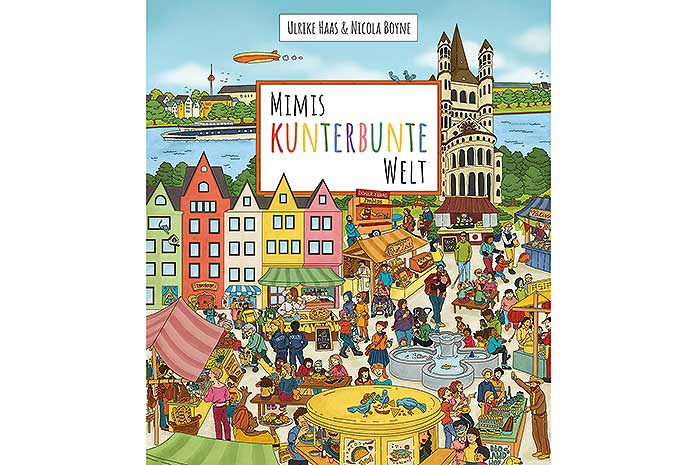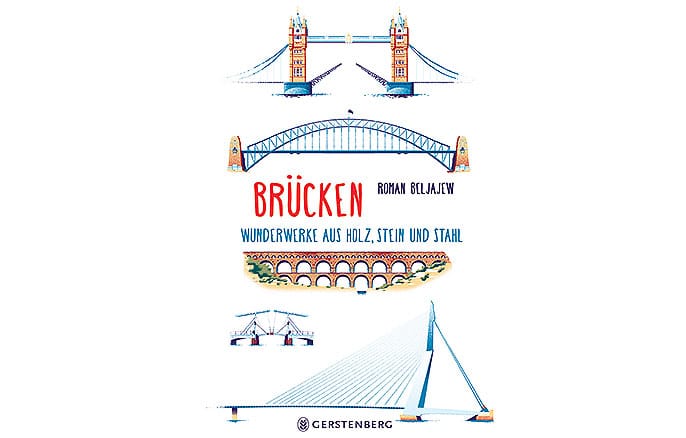Ist es heute schwerer, Junge zu sein und wie können Eltern ihre Söhne fördern?
Henri ist neun Jahre alt und hat immer Flausen im Kopf. So beschreibt es zumindest seine Mutter Susanna (47). Wenn er aus der Schule kommt, schmeißt er seinen Rucksack in die Ecke, stürmt ins Spielezimmer und drischt erstmal auf sein Schlagzeug ein. Das muss so einiges mitmachen. „Für Henri ist das Aggressionsabfuhr, der muss alles rauslassen“, sagt seine alleinerziehende Mutter.
Von wilden Kerlen und impulsiven Rabauken
Die Nachbarn haben sich schon öfter beschwert. Auch weil Henri das Wort „leise“ nur vom Hörensagen kennt. „Der ist einfach so temperamentvoll, da hilft nichts.“ Nur wenn Henri mit Kopfhörer vor seiner Playstation sitzt, wird es ruhig. „Er ist halt ein richtiger Rabauke, ein Junge eben“, erklärt seine Mutter. Manchmal kann das ganz schön stressig werden, nicht nur für sie. Auch das Umfeld bekommt Henris Impulsivität zu spüren. Die Klassenlehrerin muss ihn immer wieder zur Ruhe mahnen, Zoff mit Kumpels regelt Henri gerne mit der Faust. Und neulich, da musste seine Mutter sogar was wegen Sachbeschädigung klären.
Mädchen sind anders. Jungen auch.
Ist das „normal“ für Jungs? Gehört es zu ihrer Entwicklung, dass sie Phasen durchlaufen, in denen sie sehr temperamentvoll, besonders aggressiv und darum von außen betrachtet schwieriger sind als Mädchen?
Ja, meint Hans Hopf. Jungen haben eben andere Stärken und Schwächen als Mädchen und gehen anders damit um, schreibt der Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche in seinem Sachbuch „Jungen verstehen“. Das Verhalten von Jungen könne man nur dann richtig beurteilen, wenn man bedenke, dass die Persönlichkeit von Wechselbeziehungen zwischen Körper und Geist im sozialen Kontext geprägt werde.
Dass es mitunter große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt, ist Resultat eines sehr komplexen Zusammenspiels von biologischen, seelischen und sozialen Faktoren. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die körperliche Entwicklung. Mit Beginn der Vorpubertät zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr steigt die Produktion des Sexualhormons Testosteron bei Jungen im Körper sprunghaft an. Das ist der Startschuss für den körperlichen Umbau. Aber auch die Psyche verändert sich dadurch.
Das Testosteron macht´s
Allen voran sind die männlichen Sexualhormone bei Jungen Treiber von bestimmten Verhaltensweisen. Besonders Testosteron fördere die Kampfeslust, mache Jungen unruhig und aggressiv, schreibt Hans Hopf. Diese auf sie einströmenden Spannungen, die körperlich gesteuert werden, müssen Jungen verarbeiten.
Das tun sie anders als Mädchen, offensiver und nicht selten unbeholfener. Innerliche Spannungszustände externalisieren Jungen öfter als Mädchen, das heißt, sie richten ihre Gefühle nach außen, lassen sie im wahrsten Sinne des Wortes „raus“. Wo ein Mädchen vielleicht still weint, schreit ein Junge und haut auf den Tisch – aber nicht, weil er unbeherrschter ist, sondern weil er keinen anderen Weg sieht, seine spannungsgeladenen Gefühle loszuwerden.
Dabei neigen Jungen manchmal zu einer stärkeren Selbstliebe als ihre oft eher unsicheren Altersgenossinnen, erklärt Hans Hopf. Diese narzisstische Haltung führe dazu, dass Jungs gerade in Krisensituation Nähe und Beziehungen meiden und sich selbst überschätzen. Wo Mädchen sich zurückziehen, nachdenklich und zweiflerisch werden, gehen Jungen bisweilen aufs Ganze und werden waghalsig.
Schwächen können Stärken sein
Schon ist der „schwierige“ Junge geboren, der sich weniger anpasst und weniger gefallen will als das gleichaltrige Mädchen. Dabei können sogar störende Verhaltensweisen im Kern Stärken sein – wenn Jungen lernen, sie zu kanalisieren. Das, was sie im Umgang mit anderen und für ihr Umfeld manchmal schwierig macht, kann genau das sein, was ihre Persönlichkeit voranbringt und sie im Positiven antreibt:
• Ihre Risikobereitschaft kann sie wagemutiger und damit offener für Neues machen.
• Jungen stürzen sich eher in Abenteuer, haben Freude an Entdeckungen und können sich in technische Details versenken.
• Sie haben Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, lieben körperliche Bewegung und sind begeisterte Tüftler.

Jungen – das problematische Geschlecht?
Etwa zwölf Prozent aller zehnjährigen Jungen erhalten die Diagnose ADHS. Rund 60 Prozent der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss sind männlich. In allen Altersgruppen haben Jungen ein nachweislich höheres Unfallrisiko. Und sie sind deutlich häufiger in Kriminalfällen deutlich häufiger Tatverdächtige oder Opfer als Mädchen.
Solche Zahlen können durchaus den Eindruck erwecken, Jungen wären „schlimmer“ als Mädchen. Auffällig ist aber, dass die Grenzen zwischen normalem und unnormalem Verhalten dabei zu verfließen scheinen. Ist es gleich ein Alarmsignal, wenn ein Junge mal über die Stränge schlägt? Kann man Schulprobleme nur dem Verhalten zuschreiben und sind Unfälle immer selbst verschuldet? Meist kommen doch immer viele Faktoren zusammen.
Dennoch sieht es fast so aus, als würde jungentypisches Verhalten bisweilen pathologisiert, also ihre Empfindungen und die Art, wie sie sind, als krankhaft bewertet.
Typisch Junge
 „Den“ Jungen gibt es nicht, betont der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Frank Eckloff. Es gebe lediglich Verhaltensweisen, die bei Jungen öfter vorkommen. Wenn wir von jungentypischem Verhalten sprechen, sei dies schon eine soziale Zuschreibung. Denn unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und zeigen in ihrem Verhalten unterschiedliche Strategien, um diesen Bedürfnissen nachzukommen.
„Den“ Jungen gibt es nicht, betont der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Frank Eckloff. Es gebe lediglich Verhaltensweisen, die bei Jungen öfter vorkommen. Wenn wir von jungentypischem Verhalten sprechen, sei dies schon eine soziale Zuschreibung. Denn unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und zeigen in ihrem Verhalten unterschiedliche Strategien, um diesen Bedürfnissen nachzukommen.
„Es gibt so gut wie kein geschlechtsspezifisches, also ausschließlich bei einem Geschlecht vorkommendes Verhalten. Meist meinen wir geschlechtstypische Verhaltensweisen, also solche, die wir Männern oder Frauen zuschreiben und dann auch erwarten“, erläutert Frank Eckloff. Das resultiere daraus, dass das Verhalten innerhalb einer Gruppe von Menschen manchmal ähnlich sei, wenn sie ein wichtiges gemeinsames Merkmal verbinde. „Handelt es sich bei dem Merkmal um das Geschlecht, lassen sich ganz eindeutig übereinstimmende Bedürfnisse und Verhaltensweisen erkennen.“
Da es aber nicht nur das biologische, sondern auch das soziale Geschlecht gebe, müsse man immer bedenken, dass viele Einteilungen in typisch männlich und weiblich gesellschaftlich konstruierte Zuschreibungen seien. „Aber es ist zum Beispiel auffällig und nachweisbar, dass Jungs mehrheitlich ein größeres Bedürfnis nach Bewegung zeigen als Mädchen.“
Mehr von Frank Eckloff im Interview weiter unten.
Weiblich geprägtes Umfeld
Wie Jungen sind, hat viel damit zu tun, in welcher Gesellschaft sie aufwachsen. Unsere ist nach wie vor sehr frauendominiert: In Kitas, Kindergärten und Schulen arbeiten zum Großteil Frauen. Und auch zuhause ist trotz immer größerer Männerbeteiligung sehr oft die Mutter diejenige, die den Familienalltag organisiert und damit den größten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat. Und Frauen gehen eben zurückhaltender mit Gefühlen um, verhalten sich anders und sind auf Harmonie bedacht – das geben sie auch in der Erziehung an Jungen weiter.
Außerdem sind Jungen im 21. Jahrhundert einem verunsichernden und bisweilen ziemlich widersprüchlichen Leistungsdruck ausgesetzt. Sie sollen funktionieren, sich anpassen und Gefühle zeigen. Gleichzeitig wird von ihnen aber erwartet, dass sie einen eigenen starken Willen zeigen und ihren „Mann stehen“. Einerseits soll ein Junge also lieb und einfühlsam sein, andererseits aber auch cool und selbstbewusst, denn dies sind noch immer männliche Attribute.
Väter sind gefragt
Dabei braucht ein Junge für die Entwicklung seiner Identität unbedingt auch Männer, sagen Psychologen. In der Familie, in ihrem Umfeld, im Kindergarten und in der Schule müssen sie Vorbilder finden können, an denen sie sich orientieren und Vorstellungen für das eigene „Mannsein“ entwickeln können.
Oft fehlen sie aber, männliche Vorbilder und Einflüsse. Nicht nur in den Institutionen, in denen Erziehung stattfindet. Sondern auch daheim. Der Vater als „entwicklungsfördernder Störenfried“ sei häufig abwesend, sagt Hans Hopf. Dabei sei er in der frühen Kindheit für Jungen eine Art Befreier aus der engen Beziehung zur Mutter, später werde er zum Rivalen. So forme und organisiere er ein intensives System von Gefühlen. „Bevaterte Kinder können besser mit ihren Triebimpulsen umgehen als Kinder ohne Vater“, schreibt der Psychotherapeut. Dabei sei es egal, in welcher Familienform ein Kind aufwachse.
Als weiteren Grund für die auffälligen Jungen sieht Hans Hopf die „Angst vor Erziehung“ in vielen Familien. Eltern sehen sich oft als Freunde ihrer Kinder, drücken sich vor missliebigen Entscheidungen und Maßnahmen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dadurch entstünden aggressive Hemmungen: Statt sich dem Kind gegenüber durchzusetzen, wird schon mit kleinen Kindern, die damit völlig überfordert sind, über selbstverständliche Dinge diskutiert.
Ihr macht das schon, Jungs!
Raum zum Toben geben: Der Bewegungsdrang bei Jungs ist ausgeprägter. Langes Stillsitzen, Basteln, Malen oder Lesen fällt den meisten schwer. Geben Sie ihrem Sohn drinnen oder draußen genug Bewegungsspielräume und unterstützen Sie ihn dabei, dass er lernt, seine „Hibbeligkeit“ zu kanalisieren.
Wettkampf zulassen: Jungen wollen sich vergleichen, möchten sich mit anderen messen und herausfinden, wer größer, besser, schneller ist. Ermöglichen Sie es Ihrem Sohn, dass er in den Wettkampf mit anderen tritt – etwa beim Sport.

Niederlagen „üben“: Man muss auch mal Letzter sein können – helfen Sie Ihrem Sohn, Misserfolge locker zu nehmen und bestärken Sie ihn in dem Gefühl, dass Verlieren kein Weltuntergang ist.
Konsequent sein: Bleiben Sie dran, wenn Sie Verbote ausgesprochen haben und setzen Sie sich durch, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Jungen wollen oft mit dem Kopf durch die Wand, und „verrennen“ sich dabei. Unterstützen Sie Ihren Sohn dabei, das richtige Maß zu finden.
Medienkonsum im Auge behalten: Achten Sie darauf, dass Ihr Sohn dem Alter angemessen Zugang zu Sozialen Medien und Computerspielen hat. Vereinbaren Sie feste Spielzeiten und „kontrollieren“ Sie diese auch.
„Jungen verstehen“ von Hans Hopf
 Dr. Hans Hopf (geboren 1942) ist einer der renommiertesten Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten in Deutschland. Seit vielen Jahren befasst er sich mit der Entstehung von männlicher Identität. Was macht Männer aus, wie werden sie zu dem, was sie sind und wo beginnt der Entwicklungsprozess, der Jungen zum „schwierigen Geschlecht“ abstempelt?
Dr. Hans Hopf (geboren 1942) ist einer der renommiertesten Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten in Deutschland. Seit vielen Jahren befasst er sich mit der Entstehung von männlicher Identität. Was macht Männer aus, wie werden sie zu dem, was sie sind und wo beginnt der Entwicklungsprozess, der Jungen zum „schwierigen Geschlecht“ abstempelt?
In „Jungen verstehen“ fasst Hans Hopf seine Gedanken und Erkenntnisse verständlich zusammen. Wie läuft die kindliche Entwicklung ab, welche Rolle spielen Mütter und Väter? Wie lassen sich Verhaltensweisen von Jungen wie Aggressionen, Unruhe und Risikobereitschaft erklären? Und wie können Eltern, Pädagogen und Erzieher gut damit umgehen? Diese Fragen beleuchtet Hans Hopf eingehend und fundiert, aber so klar, dass jeder, der sich mit der Thematik befasst, etwas daraus ziehen kann. Sein Apell: Wir sollten Jungen und ihre Anliegen besser wahrnehmen, um ihnen geben zu können, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen.
Hans Hopf: Jungen verstehen, Klett-Cotta Verlag, 20 Euro
Mehr Freiraum für männliche Bedürfnisse
fratz im Interview mit Dipl.-Päd. Frank Eckloff, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut aus Frankfurt
 Ist es schwer, heute ein Junge zu sein?
Ist es schwer, heute ein Junge zu sein?
Sicher hatten es Jungen vor sagen wir mal 50 Jahren in manchen Bereichen leichter. Das gesellschaftliche Umfeld war überschaubarer, die medialen Möglichkeiten und Verführungen waren viel geringer, die Geschlechterrollen klarer. Diversität ist etwas Großartiges – allerdings auch manchmal eine Herausforderung bei der Identitätsentwicklung.
Aber vergleicht man das mal mit Kindern der Nachkriegsgeneration, erkennt man auch Parallelen: Es gab weniger Verlässlichkeit innerhalb der veränderten Familienstrukturen und viele abwesende Väter.
Auch heute sind Familien anders aufgestellt, als es traditionellerweise der Fall war. Dabei spielt der Wandel hin zu neuen Familienmodellen – ob Patchwork, alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Eltern – meines Erachtens nach keine Rolle. Entscheidend ist die Dynamik innerhalb der Familienkonstellation. Wenn Eltern ihrer erzieherischen Verantwortung aufgrund eines schwelenden Paarkonflikts nicht mehr gerecht werden, sich die Väter entziehen oder ein Junge beispielsweise zum Partnerersatz für den alleinerziehenden Elternteil wird, dann fehlt es an Orientierung, liebevoller Fürsorge und Sicherheit.
Was hat sich denn konkret verändert?
Jungen reagieren auf Unsicherheiten heute in anderer Qualität, würde ich sagen. Über das Körperliche konnten Jungen früher viele Spannungen kompensieren. Dann haben sie sich halt mal geprügelt, das wurde eher als „normal“ toleriert. Heute wird unangepasstes Verhalten – also wenn Jungs zu laut, unruhig oder ungehorsam sind – viel schneller problematisiert.
 Die Spielräume für jungentypisches Verhalten sind also enger geworden. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen in der Erziehung überdominant sind. Viele Jungen haben hauptsächlich weibliche Bezugspersonen. Da wird typisches Mädchenverhalten oft intuitiv bevorzugt. Von Jungen wird erwartet, dass sie sich anpassen.
Die Spielräume für jungentypisches Verhalten sind also enger geworden. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen in der Erziehung überdominant sind. Viele Jungen haben hauptsächlich weibliche Bezugspersonen. Da wird typisches Mädchenverhalten oft intuitiv bevorzugt. Von Jungen wird erwartet, dass sie sich anpassen.
In der Schule zum Beispiel ist kein Platz für ihren Bewegungsdrang. Dazu kommt ein oft durchgetaktetes Hobbymanagement – dann wird der Junge zum Fußball geschickt, damit er sich austoben kann. Aber selbst lässt man ihn nicht ausprobieren, wie er Spannungszustände alleine bewältigen kann. Da fehlen Freiräume, in denen Jungen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln können.
Sind Jungen also wirklich schwieriger geworden?
Sieht man sich Statistiken an, kann man bestimmt in manchen Bereichen eine Veränderung feststellen. Jungen werden vielleicht öfter bei Straftaten registriert und sind in Drogendelikte oder Unfälle verwickelt. Aber das sind nur Zahlen, keine Beweise dafür, dass das Verhalten von Jungen schwieriger geworden ist.
Es kommt immer darauf an, woran man das festmacht. Untersuchungen von 2012 belegen beispielsweise, dass nicht mehr Jungen in Psychotherapiepraxen auftauchen. Nimmt man das als Gradmesser, dann scheint das nicht zu stimmen.
Aus meiner Erfahrung hat sich aber schon die Qualität des abweichenden Verhaltens verändert. Jungen zeigen mehr Auffälligkeiten in Form von externalisierenden Störungen. Also solchen, bei denen sie aggressiv und impulsiv reagieren, wie etwa bei einer Störung des Sozialverhaltens oder wirklich der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
Was sind „Jungenprobleme“, denen Sie in Ihrer Praxis begegnen?
Viele kommen mit Auffälligkeiten, die man unter ADHS zusammenfasst. Sie zeigen eine erhöhte Impulsivität, sind hyperaktiv und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Aber diese Probleme können viele verschiedene Ursachen haben. Das muss nicht immer gleich die Diagnose ADHS sein und mit Medikamenten behandelt werden. Oft stecken auch Depressionen und Selbstwertprobleme dahinter.
ADHS ist genau genommen auch keine Krankheit, sondern eine Reaktion auf soziale Umstände und Beziehungsfaktoren. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass bei Pfadfindern siginfikant weniger ADHS-Fälle vorkommen. In der Pfadfindergemeinschaft scheint mehr Platz für jungentypisches und selbstwertstärkendes Verhalten zu sein.
Mentalisierungsschwierigkeiten erlebe ich auch öfter. Mentalisierung bedeutet einfach ausgedrückt, ablesen zu können, was im Erleben anderer vorgeht. Reflektiv lernt man so auch, seine Gefühle besser einzuordnen. Jungen gelingt das manchmal nicht so gut.
Warum fällt es vielen Jungen schwer, mit Gefühlen umzugehen?
Oft wird das von Generation zu Generation weitergegeben: Die Väter können nicht über ihre Empfindungen sprechen, also können sie auch nicht an ihre Söhne weitergeben, wie „Mann“ das macht.
Hinzu kommt, dass zu viel Emotionalität als unmännlich gilt. Wenn ein Mann seinen Gefühlen besondere Aufmerksamkeit schenkt, wird er als weich oder sensibel gesehen, alles Eigenschaften, die eher als weiblich empfunden werden. Darum wird dieser Aspekt, also wie man Emotionen wahrnimmt und ausdrückt, bei der Entwicklung von Jungen zu sehr ausgeklammert.
Wie können Eltern ihre Söhne stärken?
Sie sollten ihnen viele Erfahrungsspielräume ermöglichen. Etwas weniger Helicopterkontrolle in der Erziehung wäre gut, dafür mehr Anreize und Motivation für unstrukturierte Freiräume. Das können Alltagsinseln sein, wo ein Junge alleine für sich ist, ohne Steuerung und Reglementierung. Da muss auch mal Langeweile herrschen, damit neue Kreativität entstehen kann.
Jungen wollen auch eine Rangordnung schaffen, sich darin positionieren, dafür Widerstände überwinden. Sie müssen sich mal „reiben“, gegen etwas sein können und Konflikte austragen. Aber dafür brauchen sie auch Vorhersehbarkeit und Orientierung, also klare Grenzen und Strukturen. Dabei helfen ihnen beispielsweise Rituale des körperlichen Wettbewerbs in Form von Toben und Raufen.
Das ist natürlich eine Herausforderung für Eltern. Sie müssen in Auseinandersetzungen konsequent bleiben, sich durchsetzen und ihre Söhne mit Verständnis und Toleranz begleiten. Wichtig ist auch, dass „männliche“ Eigenschaften positiv bewertet werden und „männlichen“ Bedürfnissen in der Entwicklung der nötige Raum zugestanden wird. Ganz entscheidend sind zudem positive Beziehungserfahrungen mit – soweit vorhanden – beiden Elternteilen, die als Geschlechtervorbilder präsent sind.